Erfahrungsberichte von Betroffenen - Eigene Erfahrung mit der Retinoblastombehandlung in Österreich
Hauptmenü:
- Homepage
- Menütrennlinie 1
- Wie erkennt man ein Retinoblastom?
- Menütrennlinie 2
- Der Abpik-Test für zu Hause
- Menütrennlinie 3
- Der Grund warum das RB oft zu spät erkannt wird
- Menütrennlinie 4
- Die Voruntersuchungen
- Menütrennlinie 5
- Krankheitsverlauf
- Menütrennlinie 6
- Retinoblastomabehandlung in Österreich
- Menütrennlinie 7
- Das behandelnde Ärzteteam
- Menütrennlinie 8
- Prothesen
- Menütrennlinie 9
- Soziale Hilfestellung für Betroffene
- Menütrennlinie 10
- Hilfreiche Links
- Menütrennlinie 11
- Sehfrühförderung Nutzen und Sinn
- Menütrennlinie 12
- wichtig für RB-Betroffene!!!
- Menütrennlinie 13
- Hoffnung für Betroffene bei Familiengründung
- Menütrennlinie 14
- Behandlungszentren international
- Menütrennlinie 15
- die SHG, wie alles begann
- Menütrennlinie 16
- Retinoblastomtreffen
- Menütrennlinie 17
- Erfahrungsberichte von Betroffenen
- Menütrennlinie 18
- RB-Storys Homepages usw.
- Menütrennlinie 19
- Impressum und Kontakt
- Menütrennlinie 20
- Rechtliches, Disaclimer, Datenschutzerklärung
Erfahrungsberichte von Betroffenen
Erfahrungsberichte von betroffenen Eltern  RB-
RB-
Unsere Geschichte begann eigentlich im Frühjahr 2001.
Florian – damals 1,5 Jahre alt begann zu schielen. Es war ein leichtes schielen. Wir dachten uns nichts Besonderes dabei und waren der Meinung, dass die seitlich verlaufenden Augenmuskeln nur zu schwach für ein gerades Sehen waren. Auch 2 Bindehaut-
entzündungen machten uns nicht stutzig. Das schielen wurde immer ärger, und wir gingen zum Augenarzt. Da Florian ansonsten eher sehr lebhaft war, und überall herumkletterte, auch beim so genannten Turm bauen war er nicht ungeschickt, machten wir uns nicht die geringsten Sorgen.
Beim Augenarzt erfuhren wir, dass er bereits auf einem Auge blind war, und das andere auch schon so genannte Seh-
Es wurden die Therapie besprochen und die sah folgendermaßen aus: Enuklierung des linken Auges (das bereits blind war, und in dem 4 Tumore waren wobei einer davon 1 cm betrug. Die Netzhaut war zu ¾ abgelöst darum sah Florian auf diesem Auge nichts.) und die Erhaltung des Rechten Auges wo nur 2 Tumore waren.
Es war ein großer Schock für uns, dass ein Auge herausgeschnitten werden sollte. Wir wollten versuchen, da bei dem MR keine Metastasen nachweisbar waren, das linke Auge zu erhalten und beschlossen im Konsens mit den Ärzten zuerst eine Chemotherapie einzuleiten und dann je nach Befund weiter zu entscheiden, ob es dann doch enukliert wird oder ob man es noch erhalten kann. Die Chancen für das linke Auge, je wieder etwas zu sehen, waren sehr gering. Niemand wusste wie lange es bereits die Sehkraft verloren hatte.
Egal – wir wollten es auf jeden Fall versuchen.
Nach der ersten Chemotherapie war der 1cm große Tumor auf 6 mm geschrumpft! Auch eine Chryotherapie wurde angewandt und auch die anderen Tumore begannen zu schrumpfen.
Die Chemotherapie wurde von Florian sehr gut vertragen. Als dann die Zeit kam, wo der Ruthenium Applikator eingesetzt wurde, war es am schlimmsten für uns. Florian litt unter starker Lichtempfindlichkeit und sehr starken Schmerzen. Es wurde ihm Dipidolor gegeben. Ein starkes Opiat, ohne diesen war es nicht möglich, einen einigermaßen akzeptablen Tagesablauf zu haben. Während der Zeit, wo das Ruthenium eingesetzt wurde, waren wir ständig auf der onkologischen Station. Es mussten 3x täglich die Augen eingetropft werden, was nicht zur allgemeinen Erheiterung unseres Kindes beitrug. Es war fürchterlich!
Nach der Rutheniumbehandlung, wurde wieder eine Chemo-
Während der Chemotherapien isolierten wir uns so ziemlich von der Außenwelt. Es gab keine Besuche von Freunden und auch unsere Familien – Opas und Omas wurden selten unsere Gäste. Nur Spaziergänge mit Mundschutz wurden unternommen. Auch Geschäfte und Lokale wurden gemieden. Unser älteres Kind, lebte sehr oft bei den Großeltern, da es zu diesem Zeitpunkt noch in den Kindergarten ging, und die Ansteckungsgefahr für Florian zu groß war.
Jetzt kam aber der schwierigste Teil des Ganzen: Nun musste man das rechte (bessere Auge) abpicken, um das linke Auge das bereits erblindet war, überhaupt wieder in Betrieb nehmen zu können. (Uns wurde erklärt, dass bei kleinen Kindern das schlechter sehende Auge automatisch vom Gehirn ausgeschaltet wird, und das Kind dann nur mehr mit dem so genannten besseren Auge sieht!) Das war nun unsere Aufgabe – das Auge musste wieder sehen lernen.
Eine Sehfrühförderung wurde beantragt, und nach ein paar Wochen hatten wir eine hervorragende Sehfrühförderin für Florian organisiert. Nach sehr großen Anfangsschwierigkeiten schafften wir es doch mit Beharrlichkeit das Auge wieder sehen zu lassen. Florian fährt (mit okludiertem Auge) wieder mit dem Rad, klettert auf Bäume, fährt Ski, läuft auf Eis und so
weiter. Wir okludieren das rechte Auge mindestens 4 Stunden und Florian sieht recht gut damit. Auch eine Brille war bis dato nicht notwendig.
Nun kam der nächste Schock:
Wir mussten zur Humangenetik, wo uns erklärt wurde, dass unser Kind einen Gen Defekt hat, wir jedoch nicht. (Dies wurde mittels Bluttest herausgefunden!). Auch in unseren Familien war nicht ein einziger Fall mit RB bekannt! Sogar unser älteres Kind, hat keinen Defekt. Auch alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen wurden uns mitgeteilt.
Nach wie vor müssen wir zu Nachsorgeuntersuchungen und hoffen, dass Florian Rezitiv -
Die Angst, dass ein Rezitiv alles bisher Geschaffte zunichte macht ist immer noch da. Auch, dass durch den Gen Defekt meines Kindes weitere Krebserkrankungen folgen.
Der Grund warum unser Kind bis heute noch beide Augen hat ist der, dass wir Glück und ein hervorragendes Ärzteteam in Graz haben, und ich möchte hiermit Prof. Urban (Onkologie) und Prof. Langmann (Augenklinik) mit ihrem gesamten Ärzteteam danken, die sich wirklich sehr um das Wohlergehen der kranken Kinder kümmern, und alles in ihrer Macht stehende versuchen, um uns Betroffenen zu helfen.
Ich hoffe, dass unsere Geschichte anderen Betroffenen Mut macht und zeigt, dass man mit so einer Krankheit nicht alleine da steht.
Als es begann......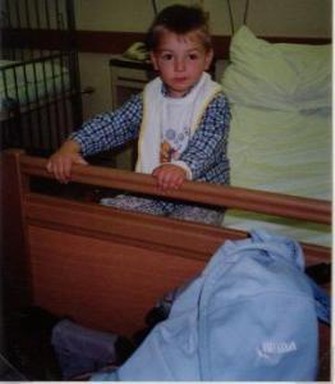
Vor der CT Untersuchung.. danach waren wir schon auf dem Weg nach Graz!

nach der Chryo -

In der Zeit in der er die Chemo erhielt, spielte er nur mit Mundschutz draussen!

In der Sehschule wurde immer kontrolliert ob die Sehkraft gleich geblieben ist oder sich verschlechtert hat.
Ildilko:
Ich bin am 27.03.1966 in Brasov (Kronstadt)/Rumänien geboren.
Ich war neun Monate alt, als mein Vater das berühmte Katzenauge in meinem rechten Auge entdeckt hat. Erstmal wurde meine Mutter von den Ärzten in Kronstadt abgewiesen: Sie wüßten nicht, was es sei, und sie solle mich auch nicht wiederbringen. Die Diagnose wurde dann von einem alten Arzt aus einer benachbarten Kleinstadt gestellt, der meiner Mutter auch die Reaktion der anderen Ärzte erklärt hat: Krankheiten, die in unserem sozialistischen Land nicht heilbar seien, dürfe es nicht geben. Er hat die Entfernung des Auges auch so kunstvoll bewerkstelligt, daß sich meine Prothese fast parallell zum anderen Auge mitbewegt.
Weitere neun Monate später war das andere Auge dran. Es hieß erstmal wieder, es sei nichts, meine Mutter bilde sich da was ein. Der alte Arzt stellte schließlich fest, auch dieses Auge sei nun krank, und daß er nicht helfen könne: Die ihm zur Verfügung stehende Technik reiche nur aus, um mir das Auge zu entfernen. Er schickte uns weiter, nach Cluj (Klausenburg), da sollte ein Professor mit der Behandlung der Krankheit experimentiert haben. Und dieser war auch ein außerordentlicher Mensch. Er hatte tatsächlich versucht, die Tochter eines Freundes zu retten, doch erfolglos. Ich bin diesen Ärzten dankbar dafür, was sie getan haben, und noch mehr dafür, daß sie mich nicht als Versuchskaninchen mißbraucht haben. Dieser Klausenburger Arzt hat versucht, durch Elektrothermokoagulation den Ablauf der Krankheit zu verzögern und hat, seine Position riskierend, meiner Mutter verraten, daß es in London Hilfe gäbe. Für meine Mutter schien damals London genauso unerreichbar, wie der Mond. Doch sie begann die Pilgerfahrten zum Gesundheitsministerium in Bukarest (16 Mal innerhalb von vier Monaten). Sie wurde immer wieder vor die Tür gesetzt, es wurde ihr erklärt, es sei nichts weiter dabei, wenn ein Kind sterbe, es würden doch zehn andere an seine Stelle geboren. Bis ihr eine Sekretärin aus Menschlichkeit verriet, das Ministerium hätte nur für wichtige Menschen Geld zur Verfügung und meine Mutter solle nach einem Sponsor suchen.
Es ergab sich, daß die unitarische Kirche 400 Jahre ihrer Gründung feierte und daß Bischöfe aus aller Welt nach Siebenbürgen anreisten. (Unitarismus = im 16. Jh. radikale Reformationsbewegung, die die Heilige Dreifaltigkeit bestritt, Michael Servetius wurde in Genf auf dem Scheiterhaufen verbrannt, andere flohen ostwärts, nach Polen u. Siebenbürgen. 1568 zählt als das Gründungsjahr der Konfession in Siebenbürgen.) Meine Eltern konvertierten zum Unitarismus und der Bischof der britischen unitarischen und freichristlichen Kirche versprach, die nötigen Geldmittel aufzutreiben. Davor hatte meine Mutter durch eine englische Familie (wieder Zufall und kolossale Menschen) Kontakt zu Prof. Stallard in London aufgenommen (er hat meines Wissens die Behandlungsmethode mit den Applikatoren entwickelt). Er hatte angeboten, den Eingriff unentgeltlich vorzunehmen und auch einen Teil der Anästhesie-
Am 16. Dezember 1968 (ich war inzwischen zweieinhalb und der klausenburger Arzt befürchtete, es sei zu spät) flogen wir los, ohne einen Penny in der Tasche. Im Flugzeug schenkte eine jüdische Passagierin meiner Mutter 10 Dollar. Am Flughafen in London wurden wir vom Bischof und von einem aus Siebenbürgen stammenden Pfarrer erwartet. Der Panda-
Ich habe viele Erinnerungen von diesen drei Wochen in London. Das nötige Geld kam an einem karitativen Teeabend zusammen. Ich saß auch da und bekam einen riesengroßen blauen Luftballon geschenkt, auf dem eine gelbe Sonne lachte. (solche fast fotografisch genaue, Erinnerungen habe ich sehr viele.) Zum Glück hat diese einmalige Strahlentherapie ausgereicht. Die Chemo bekam ich dann in Klausenburg. Und ich konnte ein ganz normales Leben führen, normal beschult werden, hatte cca. 90% Sehschärfe am linken Auge, bloß mein peripheres Gesichtsfeld fehlt fast ganz. Obwohl wir Ungarn sind, gaben mich meine Eltern in die deutsche Schule. War ein guter Schachzug, da ich mich dadurch freier in der Welt bewegen konnte. Mit 10 begannen dann die Scherereien mit dem angekündigten Strahlenkatarakt und parallell dazu mit der Iridozyklitis. In 10 Jahren bekam ich so viele Kortikoide, daß es einen Bullen umgehauen hätte. Da hat meine Mutter zu jenem Arzt in der DDR Kontakt aufgenommen, den uns noch Prof. Stallard empfohlen hatte, als die Zeit verging und wir nicht nach London fahren konnten. Prof. Lommatzsch hat mich behandelt, als sei ich sein eigenes Kind. Da wir natürlich nicht offiziell fahren konnten, mußten wir als Touristen anreisen und ich mußte "schwarz" behandelt und 1986 "schwarz" operiert werden. Nach der Wende wurde Prof. Lommatzsch u.a. vorgeworfen, Patienten unter konspirativen Bedingungen behandelt zu haben. Das war ich!!! Nachdem seine Professur neu besetzt und ihm 2 Jahre lang wegen Stasimitarbeit der Prozeß gemacht wurde, wurde er rehabilitiert. Er durfte sich entscheiden zwischen DM 30 000 einmaliger Abfindung und einer lebenslanger Monatsrente von DM 100. Er hat das letztere gewählt. No comment. Ich muß bloß sagen, ich hab mal bei seiner Sekretärin, mal bei ihm gewohnt, da wir das Hotel nicht bezahlen konnten, daß ich mich heute noch vor seinem Drängen kaum retten kann, wenn ich in Leipzig bin, da er mir neue Prothesen bezahlen will. Er ist schon mal von der Geburtstagsfeier seiner Frau weg, da ich hereingeschneit kam, hat mich in seine Praxis gefahren und gründlich untersucht.
Und dann habe ich noch nicht erzählt von der Brieffreundin aus Westdeutschland, die mir die sauteuren Kortikoide 10 Jahre lang zuschickte (eine Dosis war ein viertel Monatsgehalt meiner Mutter), von meiner mütterlichen Freundin aus Stralsund, die jedes Mal, wenn sie mit ihrer Familie in den Karpaten Urlaub machte, uns Geld wechselte (denn ab Anfang der 80er konnte man bei uns nicht mal mehr offiziell Ostgeld wechseln). Ich bin vielen Menschen gegenüber bis in die Puppen verschuldet. Das ist es, was ich aufschreiben möchte. Ich habe sehr darunter gelitten, immer wieder als Bettler dastehen zu müssen, obwohl diese Menschen es mich niemals haben spüren lassen. Ich kann meine Schuld abarbeiten, wenn ich helfe
Es paßt nur bedingt her, doch abschließend möchte ich hier Mahatma Gandhis Worte:zitieren: "Die Tyrannei ist nicht so sehr die Schuld des Tyrannen, als die des Unterdrückten. Der Tyrann vermag nämlich nur das aufzuzwingen, dem zu widerstehen das Opfer nicht die Kraft besitzt. Die eigene Schwäche und Bosheit besiegen ist daher schon der halbe Sieg." (Probleme, Ängste, Selbstmitleid sind doch ganz tüchtige Tyrannen.)
Ich muß gestehen, daß ich in den letzten Wochen das Internet systematisch nach Fachliteratur zur späten psychotherapeutischen Begleitung vormals krebskranker Kinder abgesucht und nichts gefunden habe. Ich befürchte, die Fachwelt hat uns vorerst gar nicht wahrgenommen. Eigentlich bin ich enttäuscht, andererseits reift meine Überzeugung, handeln zu müssen.
Vielleicht lenken diese Beiträge mehr Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet.
Christina:
„Schreiben ist eine Form des Gebetes“, sagt Franz Kafka und hat recht damit. Durch das Schreiben (von Tagebüchern, Briefen, literarischen Texten) kann ich mir über vieles Klarheit verschaffen und immer wieder ist es eine Möglichkeit für mich, mir meine Zweifel und Ängste einzugestehen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Schreiben befreit mich und hilft mir, zu meinem inneren Gleichgewicht zurück zu finden.
Der folgende Text entstand in einer Zeit, in der bestimmte Erlebnisse aus meiner Kindheit, die ich lange völlig verdrängt hatte, wieder zurückkamen und mich quälten. Indem ich sie in Worte fasste und niederschrieb, begann ich, mich mit dem Retinoblastom als Teil meiner Vergangenheit und mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen. Deshalb möchte ich auch betonen: So beunruhigend der Text ist (er ist mit Tränen geschrieben), das Ende ist durchaus hoffnungsvoll und positiv gemeint. Es ist der Versuch, Worte für Erinnerungen und Gefühle zu finden, die lange verdrängt waren, die ich einerseits gern aus meinem Gedächtnis ausgelöscht hätte, andererseits aber wachhalten musste, weil sie zu mir gehören, ein Teil meiner Biografie und meiner Persönlichkeit sind. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess, das anzuerkennen, aber nun kann ich sagen, dass das Retinoblastom und alle damit verbundenen Erfahrungen ein Teil von mir sind und ich sie als solchen annehme. Sie haben mich stark gemacht und zu einer Kämpferin. Auch wenn das manchmal/oft zu vorgetäuschter Autonomie führt, zur Überbetonung von Stärke und zur Schwierigkeit, auch mal Schwächen zu zeigen und zuzugeben – Willensstärke, Kampfgeist und Mut sind dann doch wertvolle Ressourcen und Überlebensstrategien.
Hier nun meine Erinnerungen aus der Zeit zwischen meinem zweiten und vierten Lebensjahr
Ich wurde im Sommer 1983 in Göttingen geboren. Meine Mutter war damals 26 und arbeitete als MTA, mein Vater war 32 und befand sich noch im Studium zum Diplomforstwirt. Als ich anderthalb Jahre alt war, stellten meine Eltern fest, dass ich schlechter sah. Beim Augenarzt und in der Göttinger Klinik stand die Diagnose auf Retinoblastom dann sehr schnell fest, ebenso die Behandlung: Ein Auge musste entfernt werden. Diese Operation wurde noch in Göttingen durchgeführt, danach wurden wir an das Uniklinikum Essen überwiesen, wo ich in den folgenden zwei Jahren (1985-
An die Heimfahrt von dieser letzten Operation kann ich mich noch gut erinnern. Natürlich war ich müde und erschöpft, dabei aber auch so erleichtert und glücklich, nun nie wieder nach Essen fahren zu müssen („Essen“, ein Wort, das für allen Schrecken steht, den es nur gibt). Der sich immer wiederholende Alptraum von Untersuchungen, Spritzen, Narkosen war endlich zu Ende. Die Bedeutung des Geschehens begriff ich damals nicht: Was es heißt, nie mehr sehen zu können, oder was es heißt, dass mein Leben gerettet worden war und ich an dieser Krankheit auch hätte sterben können.
Für meine Eltern und Großeltern war es hingegen ein sehr trauriger Tag. Sie hatten bis zur letzten Minute gehofft, die Entfernung meines zweiten Auges könnte doch vermieden und wenigstens ein kleiner Sehrest gerettet werden. Für mich war nun alles in Ordnung, die schreckliche Zeit vorbei, eine Zukunft im Kindergarten und ein ganzes Leben lagen vor mir – für meine Familie war es ein trauriges Ende zweier schrecklicher Jahre. Vor allem für meine Mutter, die alle drei Wochen zu Untersuchungen und Behandlungen mit mir nach Essen fuhr, muss es sehr schwer gewesen sein. Mein Vater konnte sie nur selten begleiten, das Elternhaus gab es noch nicht, die Ärzte hatten kaum Zeit für ein Patientengespräch und die Krankenschwestern konnten außer kleinen netten Gesten und ein paar Worten auch nicht viel tun, um sie aufzufangen. Ich glaube, meine Mutter und ich machten uns gegenseitig Mut und gaben einander Kraft.
Doch im August 1988 war das Kapitel Retinoblastom abgehakt und erledigt. Ich wollte leben, spielen, die schreckliche Zeit vergessen. Dies gelang mir während einer wunderschönen dreijährigen Kindergartenzeit in dem evangelischen Kindergarten unseres Ortes, wo ich bald einen großen Freundeskreis hatte.
Aber ich war durch Retinoblastom erblindet und das bedeutete u.a. auch, dass die Frage, auf welche Schule ich gehen sollte, zwar recht einfach zu beantworten, aber schwer umzusetzen war: Meine Eltern (und ich natürlich auch!) wollten eine integrative Beschulung, also den Besuch einer Regelschule. Integration von körperbehinderten – auch von blinden – Kindern gab es zu der Zeit schon vereinzelt, sie war und ist aber im Einzelfall immer noch schwer durchzusetzen. Zwei Jahre lang kämpften meine Eltern – hier vor allem mein Vater, der unzählige Anträge und Briefe schrieb, reihenweise Aktenordner für die Korrespondenz anlegte, sich an Zeitung und Rundfunk wandte, an den Ministerpräsidenten und den Landtag von Niedersachsen, die Schule vor Ort, den Schulträger, die Blindenschule in Hannover, die zuständige Bezirksregierung... Das Ergebnis: 1990 wurde ich in die erste Klasse eingeschult zusammen mit meinen Kindergartenfreunden. Die zuständigen Behörden hatten schließlich einem Integrationsversuch zugestimmt, eine engagierte Klassenlehrerin hatte sich bereit erklärt und ich bekam sonderpädagogische Betreuung von einer Lehrerin der Blindenschule Hannover, die mir die Blindenschrift beibrachte, meine Klassenlehrerin beriet und mir und meiner Familie zur Seite stand.
Meine integrative Beschulung entwickelte sich über die Jahre mehr und mehr zur Erfolgsgeschichte: An die Grundschule schloss sich die Orientierungsstufe in der fünften und sechsten Klasse an, danach der Wechsel auf das zuständige Gymnasium, schließlich mein Abitur im Sommer 2003 (mit der „Traumnote 1,0“). Unterbrochen wurde dies nur von meinem halbjährigen Auslandsaufenthalt in Kanada während der elften Klasse, den ich selbst organisierte und in der Nähe von Toronto an einer sehr aufgeschlossenen Privatschule und in einer wundervollen Gastfamilie verbrachte.
Während meiner gesamten Schulzeit hatte ich viele sehr aufgeschlossene tolle Lehrer, die bereit waren, mit mir als Schülerin etwas Neues auszuprobieren und dadurch gemeinsam mit mir zu lernen. Für ihren großen persönlichen Einsatz dabei bin ich sehr dankbar.
Zu Beginn mussten meine Eltern viele Skeptiker davon überzeugen, dass meine integrative Beschulung möglich ist und keine Nachteile für meine Mitschüler mit sich bringen würde. Gerade dann hängt so viel daran, dass sich einzelne Menschen auf solch ein Experiment einlassen, vorurteilsfrei einfach ausprobieren, was möglich ist und ob die Probleme, die befürchtet werden, sich erstens einstellen und zweitens lösbar sind. Die große rückblickende Zustimmung ist zwar erfreulich, aber sehr bequem und ungefährlich.
Meine Klasse galt, so weit ich weiß, immer als Vorzeigeklasse mit einem guten Sozialverhalten und hervorragendem Klassenzusammenhalt. Ob das an mir lag oder sich aus einer Verkettung vieler positiver Umstände so ergab, möchte ich dahin gestellt lassen. Ab der 11./12. Klasse gab es allerdings einige Spannungen und Neider und immer wieder Vorwürfe, ich würde bevorzugt behandelt. Reste davon halten sich noch bis heute und tun mir, wenn ich darauf stoße, oft weh. Aber: So bin ich nun einmal, kann nicht gut in der Masse untertauchen und das hat eben positive und negative Seiten, ruft Neider und Bewunderer auf den Plan (oft beides in einer Person) und ich kann nur hoffen, dass ich niemals arogant und selbstgerecht oder verbittert und argwöhnisch deswegen werde. Mein neuestes persönliches Motto scheint da eine ganz gesunde Haltung auszudrücken: „Eine von Milliarden und doch die Eine.“
Während meiner Schulzeit hatte ich ein recht umfangreiches und vielfältiges Freizeitprogramm: (klassische) Gitarre im Einzelunterricht, im Duo und im Gitarrenorchester, Chor, reiten, Tanzunterricht, lesen, Kino, Theaterbesuche. Meine Eltern bemühten sich sehr, mir so viele verschiedene Angebote wie möglich zugänglich zu machen. Ich bin mit der Zeit auch immer neugieriger und abenteuerlustiger geworden, was mich zuerst nach Kanada verschlug und dann nach dem Abitur in eine fremde Stadt (Göttingen) zum Theologiestudium brachte.
Göttingen habe ich mir Schritt für Schritt zu „meiner“ Stadt gemacht. Schnell habe ich hier sehr gute Freunde gefunden, mit denen mich inzwischen so viel verbindet, dass ich hoffe, dass es mit einigen „fürs ganze Leben“ halten wird.
Nach drei Jahren Göttingen treibt mich meine Abenteuerlust jetzt weiter nach Zürich, wo ich ab Oktober für ein Jahr leben und studieren werde, um dann in Göttingen mein Examen abzulegen. Danach möchte ich ein Psychologiestudium anschließen, um dann höchstwahrscheinlich in den therapeutischen Bereich zu gehen (obwohl auch eine wissenschaftliche Laufbahn nicht ausgeschlossen ist).
Und wo ist da noch das Retinoblastom? Weit in der Vergangenheit, abgehakt und vergessen, unwichtig für meine Gegenwart? Das habe ich lange gedacht und gewünscht, bis es mich kurz vor meinem 18. Geburtstag ganz plötzlich wieder einholte in Form unerklärlicher Schwindelanfälle und Panikzustände. Damals sprach meine Mutter zum ersten Mal aus, dass ich aufgrund der Genmutation und der Strahlenbehandlung ein erhöhtes Krebsrisiko habe. Das traf mich völlig unvorbereitet wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich dachte: Mit spätestens 30 ist dein Leben zu Ende.
In der folgenden Zeit begann ich dann, mehr und mehr zu spüren, dass es da noch mehr gab als die Angst vor einem Zweittumor. Da ist einerseits die Notwendigkeit, die Kindheitserlebnisse aufzuarbeiten, die ich in „Wehrlos“ beschreibe. Ein anderes Thema, von dem ich vorher nie geglaubt hätte, dass es zu einem Thema für mich werden würde, ist die Akzeptanz meiner Behinderung und der selbstbewusste Umgang damit. Und schließlich ist da die Frage nach eigenen Kindern, die mit 50%iger Wahrscheinlichkeit meine Genmutation erben werden. (Übrigens habe ich eine jüngere Schwester, die kerngesund ist. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern den Mut hatten, sich für ein zweites Kind zu entscheiden.)
Das sind drängende Fragen und Gefühle, die sich nicht einfach wegschließen lassen. Meine Eltern tun dies bis heute, über Retinoblastom wird nicht oder nur sehr widerwillig gesprochen, weil zu viele schmerzhafte Erinnerungen, auch Schuldgefühle und Selbstvorwürfe damit verbunden sind. Obwohl ich verstehen kann, dass meine Eltern nicht oder nicht mehr als unbedingt nötig darüber sprechen oder nachdenken wollen, machen mich dieses Schweigen und diese Mauern oft traurig und auch wütend. Ich denke, es würde auch meinen Eltern gut tun, sich mit meiner Behinderung und deren Ursache auseinanderzusetzen, und ich wünsche ihnen, dass sie es eines Tages schaffen.
Ich habe mich für mich inzwischen gute vier Jahre intensiv mit dem Thema Retinoblastom beschäftigt und das hat mir und meiner persönlichen Entwicklung sehr gut getan, sodass ich heute sagen kann: Retinoblastom gehört zu mir dazu, ist aus meinem Leben nicht wegzudenken und das akzeptiere ich so, mache das Beste draus und freue mich sogar, dass ich durch den Krebs und die Folgen auch viele Fähigkeiten entwickelt habe, viele wunderbare Menschen getroffen habe, die mir sonst nicht begegnet wären. (Und das gilt schließlich für jeden und jede von uns mit unseren jeweiligen Biografien und verschlungenen Lebenswegen.)
Auf diesem Weg, der für mich wohl nie vollständig abgeschlossen sein wird, haben mir meine Freunde in Göttingen und anderswo, die Kontakte hier im Forum (vor allem Ildiko), kurze Besuche im Elternhaus in Essen sehr geholfen. Vor allem aber hat mich eine wunderbare Therapeutin in einer zweijährigen Therapie auf diesem Weg begleitet, getröstet, ermutigt und mit viel Einfühlungsvermögen, Kreativität und Humor mich mir selbst ein großes Stück näher gebracht.
So haben mir viele Menschen Hilfe, Wärme, Kraft und Mut gegeben. Dafür bin ich zutiefst dankbar und möchte davon so viel wie möglich weitergeben.
Geschichte von Thomas
Ich bin im Juni 1972 geboren, nach dem ich rund um die Augen (ich weiß leider nicht ob eins oder beide) ganz gelblich war, ist meine Mutter zum Augenarzt gegangen. Wie lange es dann gedauert hat bis ich in der Essener -
Die Kinderklinik wollte dann, dass ich 6 Wochen später noch mal an der Lunge geröntgt werde, da es wohl einen Schatten gab. Zum Glück beruhte dieser auf einen Infekt oder ähnlichen. Ich hatte keine Metastasen.
Als Nächstes kommt das rechte Auge.
Wo mir das linke Auge entfernt wurde, lag ich 2 Tage in der Uniklinik, anschließend noch 1 ½ Monat, wegen des gesundheitlichen Zustands aufgrund des linken Auges.
Am rechten Auge stellte man erst 3, kurze zeit später den 4. Tumore fest. Das war im Dezember 1972. Die 4 Tumore wurden mit Lichtkoagulation behandelt. Vom Anfang März 73 bin Anfang Mai 73 lag ich in der Strahlenklinik. Wo verschiedene Bestrahlung Therapien angewandt wurden. Leider ist die Qualität der Kopie teilweise, so schlecht, dass ich sie nicht genau genug lesen kann. (Sie wurden damals noch mit Schreibmaschine geschrieben). In der Strahlenklinik sagte man mir im 02.2011, dass ich wohl insgesamt 4 verschiedene Bestrahlungsarten hatte. Eine Bestrahlungsart wurde damals neu für RB ausprobiert und schnell wieder eingestellt. Der Arzt meine, dass eventuell, da die Schwerhörigkeit verkommen könnte.
September 73 Cryo-
Danach waren keine neuen Tumore mehr dazugekommen. Ich war 1988 also mit fast 16 Jahren das letzte mal in der Uniklinik zur kontrolle. Die letzte NKU war glaub ich mit 13 oder 14 Jahren. Das ist heute wohl früher vorbei. Ich gehe heute zwei mal im Jahr zum Augenarzt, wo bei einmal im Jahr die Netzhaut gespiegelt wird.
Durch die Behandlung erlitt ich, 1983 einen Grauenstar. 1986 als ich fast blind war, wurde dieser in Essen-
Zu dem bin ich, seit ich denken kann, nachtblind und sehr stark lichtempfindlich. Bei lesen oder am Computer benötige ich einen starken Kontrast.
Ende 1993 hatte ich, eventuell durch einem Gerstenkorn verursacht, eine Entzündung in einer Entzündung. Dies hatte mein damaliger Augenarzt so auch noch nicht gesehen. Da er nicht wusste, welche Augenklinik in meinem Fall die Richtige ist, hat er das Auge für mehr als eine Woche abgedunkelt.
Später, da weis ich nicht wann es eigentlich anfing, bekam ich eine Verkalkung der Hornhaut. Die von der Nase Richtung Augenmitte sich ausdehnt. Die ist oft unangenehm und immer wieder auch schmerzhaft. Da gegen nehme ich Künstlichtränenflüssigkeit. Da durch der Verkalkung und der spuren der der Therapien im Kindesalter, der Tränenfilm reist. Mein Sehvermögen wird durch diese Verkalkung, auch stark beeinträchtigt. Ich sehe unscharf und Nebel, dieses wird in der Zukunft wohl auch noch zu nehmen.
Mein aktuelles Sehvermögen lieg bei 10 Prozent, dass ist der Messbare wert, real ist es eher weniger, da es immer von vielen Faktoren abhängig ist.
Soweit ist dies meine Krankengeschichte zu RB und dessen weiteren Verlauf. Ich weiße darauf hin, das die Medizin in den 38 Jahren viele fortschritte gemacht hat. Selbst bei meinem 7 Jahre jüngeren Bruder ist es ganz anderes.
Wir haben die vererbbare form von RB. Wir sind 3 Geschiester, wobei unsere ältere Schwester die Krankheit nicht hat. Sie hat 4 Kinder (3 Mädchen und 1 Junge) die die Krankheit auch nicht bekommen haben. Mein Bruder hat einen Jungen, wo die Krankheit auch auftrat. Ich selbst habe keine Kinder.